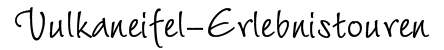Die Eisenindustrie der Eifel hat eine sehr lange Tradition. Bereits im 7./6. Jahrhundert v.Chr., während der sogenannten Hallstatt-Zeit, läßt sich Eisenverhüttung in der Eifel nachweisen. Im Jahr 1928 wurden bei Ausgrabungen von Keltengräbern bei Hillesheim die Reste einer Eisenschmelze gefunden. Sie gilt bis heute als die älteste ihrer Art nördlich der Alpen. Durch viele Ausgrabungen belegt ist die Verhüttung der Eisenerze durch die Römer bis ins 3./4. Jahrhundert n.Chr.
Ab dem 15. Jahrhundert konnte man durch die Verbesserung der Produktionsabläufe das Eisen gezielt verflüssigen. Es wurden nun Herdgussplatten, Kanonen, Haushaltsgegenstände und vieles mehr in Sand- und Lehmformen gegossen. Damit begann die Blütezeit der Eifeler Eisenindustrie.
Gefördert durch die Landesherren entstanden bis zum 19. Jahrhundert ca. 50 Hüttenwerke in der Eifel. Sie produzierten zeitweise etwa 10 % des in Europa hergestellten Eisens, das in erster Linie auf dem Kölner und dem Trierer Eisenmarkt gehandelt wurde. Die Herkunft vieler Hüttenleute und die Absatzwege der unterschiedlichen Produkte lassen erkennen, dass die Eifel Bestandteil des Wirtschaftsgebietes Westliches Mitteleuropa war.
Die intensiven Verbindungen in die Wallonie, nach Lothringen und Luxemburg sowie in die Niederlande verdeutlichen dies. Anfang des 19. Jahrhunderts waren die oberflächennahen Lagerstätten fast vollständig abgebaut und der Niedergang der Eifeler Eisenhütten begann. Nach 1814 kam von England verstärkt Eisen auf den Markt, welches günstiger war als das Eisen aus der Eifel.
In England wurden die Erze nicht mehr mit Holzkohle, sondern mit preiswerterem Steinkohlekoks verhüttet. Zudem ersetzten sie durch die Dampfmaschine die von der Natur abhängige Wasserkraft. Durch das Fehlen des Rohstoffes Steinkohle hatten die Eifeler Hütten dieser Neuerung nicht mehr entgegen zu setzen.